… um Leben und Tod, Hoffnung und Mut – die Herausforderungen der personalisierten Medizin in der Onkologie
Die Behandlungsmöglichkeiten für die in Europa häufigen Krebserkrankungen haben sich in den letzten 30 Jahren entscheidend verbessert. Während Patienten mit beispielsweise Dickdarm- oder Lungenkrebs in fortgeschrittenen Krankheitsstadien in den 90er Jahren nur sehr begrenzte Therapieoptionen hatten und in der Regel wenige Monate nach Diagnosestellung verstorben sind, gibt es heute eine Vielzahl neu entwickelter Medikamente mit entscheidend verbesserter Behandlungsperspektive.

Zunächst waren es Weiterentwicklungen bestimmter Chemotherapeutika, die nach 2000 die Therapieoptionen verbreitert haben. Allerdings sind Chemotherapeutika über längere Zeiträume verabreicht meist sehr toxisch und schon dadurch in der Anwendung limitiert. Weitere Medikamentenentwicklungen der letzten 20 Jahre umfassen die Gruppen der sogenannten Signalinhibitoren, Rezeptorantagonisten, Antikörperkonjugate sowie Checkpoint Inhibitoren, die ihre Wirkung gegenüber speziellen Zielstrukturen der Krebszelle entfalten und eine therapeutische Wirksamkeit nur bei Vorhandensein der entsprechenden Merkmale aufweisen.
Dieser Zusammenhang hat die Onkologie in den letzten zehn Jahren unter dem Stichwort „personalisierte Medizin“ um neue, im Einzelfall sehr wirksame Behandlungsperspektiven bereichert. Obwohl Patienten in fortgeschrittenen Krankheitsstadien auch mit den neuen Medikamenten nicht häufiger geheilt werden, so haben sie doch eine mitunter jahrelange Überlebensperspektive mit stillstehender, chronisch gewordener Erkrankung und unter fortgesetzter Therapie.
Grundlage für eine Therapieentscheidung mit modernen Medikamenten ist eine genaue, immunhistochemische und zumeist auch molekulargenetische Untersuchung einer möglichst aktuell entnommenen Tumorprobe. Das so erhobene Profil bestimmter Biomarker wird zusammen mit klinischen Aspekten der Erkrankung im sogenannten molekularen Tumorboard diskutiert und eine Therapieempfehlung erarbeitet. Die Komplexität der Analysen erfordert mitunter mehrere Wochen Zeit und damit entsteht eine signifikante Latenz bis zu einem möglichen Therapiebeginn.
„... Bitte geben Sie mir etwas Hoffnung. Danke ...“
Im Frühjahr 2017 stellte sich ein Anfang 50-jähriger Patient, bekannter Rechtsanwalt in Frankfurt, zusammen mit seiner Ehefrau zur Beratung im Sinne einer Zweitmeinung ambulant vor. Zuvor war extern die Diagnose eines metastasierten Pankreaskarzinoms mit Lebermetastasen gestellt worden. Der Patient hatte mehrere Aktenordner mit Ergebnissen seiner molekularen Tumoranalysen dabei sowie eine computergestützte Biomarkerauswertung und eine Liste mit 27 möglichen Medikamenten zur Behandlung seiner Erkrankung. Das Gespräch verlief seitens des Patienten nahezu euphorisch, er lobte die Organisation der Ambulanz, berichtete über seine strukturierte Sport-, Ernährungs- und Psychotherapie und wusste bereits, dass nach Therapiebeginn ein Zeitraum von zwei Monaten abzuwarten sei, bis zum ersten Mal ein CT über den Behandlungserfolg Aufschluss geben würde. Schnell verließ er den Besprechungsraum, besondere Fragen hatte er mir eigentlich nicht gestellt. Am selben Nachmittag erhielt ich eine E-Mail von diesem Patienten, in der er nochmals alle Umstände seiner Behandlung euphorisch lobte: „ …. alles Besprochene klappt wunderbar, die Therapie vertrage ich sehr gut, Sport und Psychotherapie sind ideal, alles bestens, aber – irgendwie fehlt mir komplett der Mut. Bitte geben Sie mir etwas Hoffnung. Danke ...“
Nur zwei Tage später ein ähnliches Erlebnis: ein etwa 70-jähriger Patient mit Dickdarmkrebs, Leber- und Bauchfellmetastasen, extern diagnostiziert, die Beschlüsse der molekularen Tumorboards zweier Uni-Kliniken lagen vor, meine Zweitmeinung war gefragt. Wir gingen die Untersuchungsergebnisse durch, besprachen die Empfehlungen, alles schien bereits verstanden zu sein und wieder war mir die Informationslücke nicht recht bewusst. „ ...ja, hier steht ja alles, beide Uni-Kliniken schreiben etwas Ähnliches, aber wissen Sie – mir hat noch niemand erklärt, ob mir diese Therapie helfen kann und ob sie gut für mich ist …“
Mit Mut auf allen Seiten kann es gelingen, über tabuisierte Fragen zu sprechen
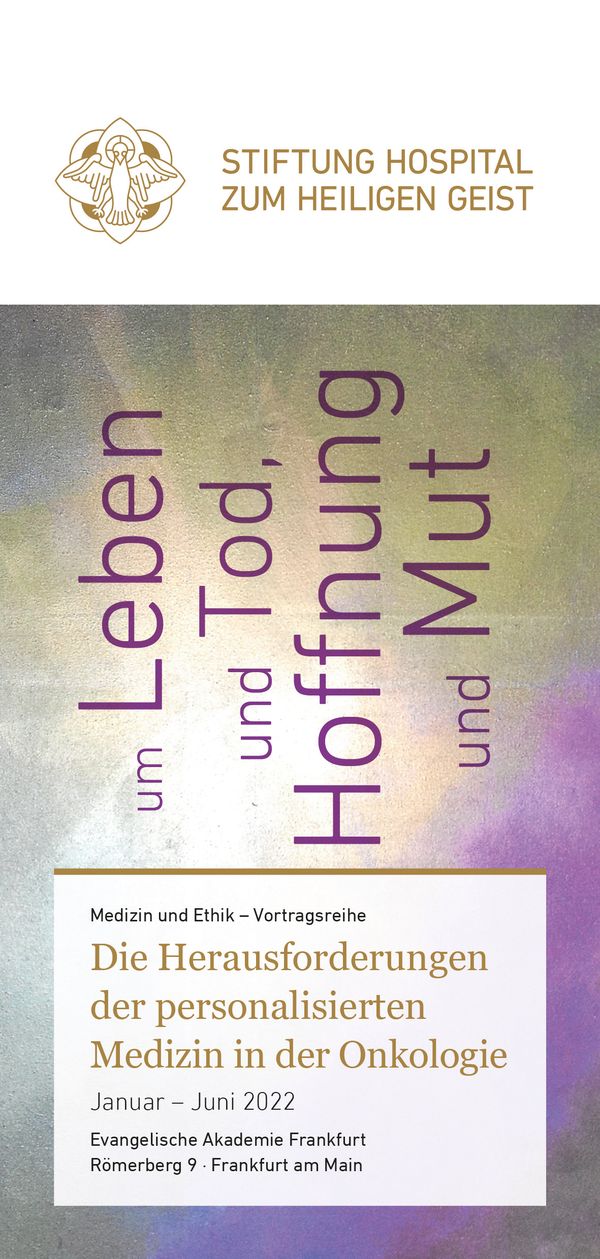
Viele ähnlich gelagerte Beispiele könnten hier aufgezählt werden – was war hier passiert? In den letzten 25 Jahren zuvor hatte mich nie ein Patient explizit gebeten, ihm Hoffnung zu geben. Das war immer das klare Resultat eines Therapieplanungsgesprächs, in dem die Ausgangslage der Erkrankung, die möglichen Behandlungsalternativen zusammen mit den zu erwartenden Nebenwirkungen und Wirkungen unter Benennung eines erreichbaren Behandlungsziels erörtert wurden. Bei dieser Gelegenheit kamen existenzielle Fragen zur Sprache, Angst vor der Behandlung, Angst vor einem möglichen Therapieversagen, Angst vor körperlichen Beschwerden, vor Funktionsverlust, vorsozialen Folgen der Krebserkrankung, vor einem nahenden Lebensende. In der Auseinandersetzung mit diesen Fragen, für die es allzu oft keine verbindlichen Antworten geben kann, konnte der Patient jedoch eine eigene Position und Haltung entwickeln, die seine Besorgnis, aber auch seine Ressourcen berücksichtigte. Er konnte eine Behandlung beginnen und sich ihren Belastungen und dem offenen Ausgang mit den individuellen Methoden der Bewältigung stellen.
Im Zeitalter der individualisierten Medizin mit maßgeschneiderten Therapiekonzepten nach hochaufwändiger Genanalyse und Computeralgorithmus wird eine sehr hohe Erwartungshaltung an einen unbedingten Behandlungserfolg – bei Ärzten und Patienten – provoziert. Die diagnostischen Prozeduren und die komplexen Ergebnisprotokolle binden die volle Aufmerksamkeit und Gedankenkapazität des Patienten. Empfindungen von Leid, Angst und Hoffnungslosigkeit werden im Arzt-Patienten-Gespräch häufig zurückgedrängt, gelten sie doch als Ausdruck von Schwäche und Hilflosigkeit und stehen dem unbedingten Glauben an den zweifelsfrei eintretenden Therapieerfolg im Sinne eines schlechten Omens entgegen. Tragischerweise führt dies dazu, dass Sorgen und Ängste unausgesprochen bleiben. Sie werden so nicht selten für den Patienten und seine Lebenspartner zu einem großen Tabu. Was folgt, ist gedankliche Isolation und Schweigen.
Nach unserem Verständnis ist es auch im Zeitalter der hochtechnisierten, personalisierten Möglichkeiten die Aufgabe von Medizin und Pflege, den Patienten in seiner Gesamtheit wahrzunehmen, auf seine körperlichen, seelischen, sozialen und spirituellen Bedürfnisse zu achten und ihn mit seinen individuellen Ressourcen und Wünschen so weit wie möglich und mündig in Behandlungsentscheidungen einzubeziehen. Mit Mut auf allen Seiten kann es gelingen, über tabuisierte Fragen zu sprechen. So können sich für den Patienten neue Wege öffnen, das Leben mit der Erkrankung in wahrhaftiger und ehrlicher Kommunikation und Selbstbestimmung zu führen.
Konnte das gelingen? Eine Patientin, 48 Jahre alt, diagnostiziert mit weit fortgeschrittenem Magenkarzinom, angewiesen auf parenterale Ernährung zuhause, hatte einen 14-jährigen Sohn, dem sie bislang nichts von ihrer Erkrankung erzählt hatte. Trotz evidenten intensiven Behandlungsbedarfs mit täglichen Infusionen zuhause wurde die Krankheitstatsache vollständig tabuisiert. Die Patientin erschien in Begleitung ihres Ehemanns zum Vortrag „So stirbst Du“. Alles Wissenswerte um das Versterben in Deutschland wurde vermittelt. Die Ausstellung des Leichenscheins, der Transport des Leichnams, die Organisation des Begräbnisses, der Ort des Grabs, die Austragung aus dem Melderegister, Vorschriften, Pflichten, Gestaltungsmöglichkeiten der Hinterbliebenen waren die Themen. Ein paar Tage nach dem Vortrag erschien die Patientin zu ihrem nächsten Ambulanztermin. Sie begegnete mir gelöst und heiter und bedankte sich herzlich für den Vortrag. Die Patientin und ihr Ehemann hatten ihrem Sohn am nächsten Tag von diesem Vortrag berichtet und das Vortragsthema als Vehikel nutzen können, um die eigene Krankheitsrealität zu thematisieren. Das Tabu um ihre Erkrankung war gebrochen und der Sohn konnte in das offene Erleben der Krankheitsaspekte, die Erwartung des nahenden Todes und die Planung des Begräbnisses einbezogen werden.
Wie kann es nun gelingen, im Verhältnis zur hochtechnisierten Präzisionsmedizin Fragen um seelische Not, Angst und Hilflosigkeit ebenbürtig zu adressieren? Zusammen mit Prof. Dr. theol. Kurt W. Schmidt aus dem Zentrum für Ethik in der Medizin Frankfurt haben wir im Jahr 2017 die Vortragsreihe „ ... um Leben und Tod, Hoffnung und Mut – die Herausforderungen der personalisierten Medizin in der Onkologie“ begonnen. Exkurse in Wissenschaft, Kunst, Philosophie, Theologie, Musik, Literatur und Sport sollten Erfahrungen mit Visionen verbinden und allen Akteuren des Behandlungsgeschehens Anregungen vermitteln, wie existenzielle Bedürfnisse unserer Patienten besser artikulierbar werden und so in der Behandlung unter Einbeziehung der Patientenwünsche angemessen adressiert werden können.
Die Gespräche rund um die Vorträge machen deutlich, wie wichtig die Verständigung aller an einer onkologischen Therapie beteiligten Akteure ist
Nach einer Laufzeit von fast fünf Jahren hat die Vortragsreihe in unregelmäßigen Abständen einen festen Stamm von Zuhörern aus dem Kreis unserer Patienten, der Pflege, aus Klinik und ambulanter wie stationärer Palliativmedizin sowie onkologisch tätiger Ärzte und weiterer interessierter Personenkreise gewonnen. Über die jeweilige spezielle Vortragsthematik hinaus ist eine interdisziplinäre Diskussion angestoßen worden über die essenzielle Bedeutung der ärztlichen Positionierung in der Therapieberatung, der Empathie-getragenen Besprechung existenzieller Fragen des Patienten, die Vermeidung angstgetriebener Tabus und die sachgerechte Einbindung technischen Fortschritts in die individualisierte Diagnostik und Therapie onkologischer Erkrankungen. Die Gespräche rund um die Vorträge machen deutlich, wie wichtig die Verständigung aller an einer onkologischen Therapie beteiligten Akteure ist, um eine klare, gemeinsame Zielsetzung für die Behandlung zu definieren und mit fachlich begründetem Optimismus auf allen Behandlungsebenen empathisch zu verfolgen.
Nach der Sommerpause werden weitere Beiträge auf der Website der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist und dem Internetauftritt der Evangelischen Akademie Frankfurt angekündigt.

Prof. Dr. med. Elke Jäger
Fachärztin für Innere Medizin, Fachärztin für Hämatologie und Onkologie, Palliativmedizin
| Telefon | |
| Fax | (069) 769932 |
| fernandez.alicia(at)khnw(dot)de |
